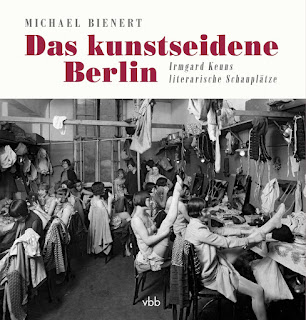| |||
| Borsigs Arkaden auf dem TU-Gelände |
Entdeckt habe ich die Spolien durch einen Zufall: In der Senatsbibliothek fiel mein Blick auf eine Neuerwerbung, Dorothea Zöbls „Der vergessene Garten der TU Berlin“ (Gebrüder Mann Verlag, 2019, 140 Seiten, 29,90 Euro). Ein wunderbar gelungener, hervorragend illustrierter Stadtteilführer, der die Augen für die historischen Schichtungen öffnet im Dreieck zwischen Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Fasanen- und Hardenbergstraße. Bis in die 1950er-Jahre durchschnitt dieses Gelände die Kurfürstenallee, inzwischen zur Flanierstrecke umgewandelt, mit reizvollen Einblicken in die Bildhauerateliers der Universität der Künste und die kleine Fabrikstadt, die seit der Kaiserzeit die ehemalige Technische Hochschule mit Wärme und Strom versorgte. Zur Zeit ist man da fast ganz alleine, denn die TU-Institute sind wegen Corona für den Publikumsverkehr geschlossen. Der Campus aber ist weiterhin für Spaziergängerinnen und Spaziergänger zugänglich.
Zöbls Buch ruft auch politische Geschichte in Erinnerung, etwa die Sitzungen des Deutschen Bundestages, der in den 1950er-Jahren im neusachlichen Physikgebäude tagte. Dort am Eingang erinnert immerhin eine Tafel an Ernst Ruska, nach dem der Bau heute benannt ist: Ruska erfand um 1934 Elektronenmikroskop und erhielt 1986 den Physiknobelpreis. Überhaupt wundert man sich, wie wenig Information zur Geschichte auf dem Campus zu finden ist. Dorothea Zöbls Buch geht von den Spolien aus und befragt diese Fundstücke detektivisch nach den komplexen historischen Zusammenhängen, in denen sie standen. Es ist ein großes berlinologisches Vergnügen, ihrer Recherche zu folgen.